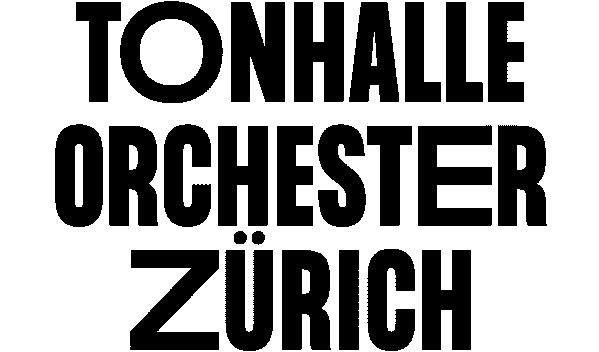Ein Land, zwei Klangwelten
Traditionelle Musik, westliche Klassik: Die Musikszene im Iran war schon immer vielfältig. Zwei Protagonist*innen sind demnächst in der Tonhalle Zürich zu Gast.
Zum Beispiel Kian Soltani: Der 31-jährige Cellist ist Österreicher, aufgewachsen in Vorarlberg. Aber er interessiert sich zunehmend auch für die Musik aus der iranischen Heimat seiner Eltern: Wenn er nun unsere kommende Saison als Fokus-Künstler mitprägt, wechselt er auch mal vom Cello zur Kemantsche.
Oder Farzia Fallah: Die 43-jährige Komponistin ist in Teheran aufgewachsen; sie habe immer ihren eigenen Weg gesucht, sagt sie, und sie hat ihn gefunden. Mittlerweile lebt sie in Deutschland und bringt im Dezember ein Werk nach Zürich, dessen Titel verschiedene Deutungen zulässt.
Die beiden sind zwei von vielen Musiker*innen, die iranische Klänge und Geschichte(n) in die Welt hinaustragen. Es sind ganz unterschiedliche Klänge: Die persische Musikszene war immer schon bemerkenswert vital und vielfältig. Und sie war und ist eng verbunden mit gesellschaftlichen Entwicklungen – nicht nur bei den im Laufe der Geschichte und auch in der Gegenwart wieder wichtigen Protestsongs.
Ein Orden für den «Persischen Marsch»
Ab dem 19. Jahrhundert verlief die musikalische Entwicklung in Persien, das seit 1935 offiziell Iran heisst, auf zwei parallelen Gleisen. Auf dem einen wurde die jahrhundertealte persische Tradition von Generation zu Generation weitergereicht: mit regional geprägten Volksmusiken und einem damit eng verwandten klassischen Stil, mit einem reichen Instrumentarium und starken Stimmen, mit einem auf 22 Stufen beruhenden Tonsystem und komplexen Reihen von melodischen Figuren, sogenannte Radīfs, welche die Improvisationen strukturieren.
Die andere Schiene verband Europa und Persien. Ausgebaut wurde sie von Nāser ad-Din Schah (1831-1896), der sich für westliche Ideen und Militärkapellen begeisterte, Johann Strauss als Dank für seinen «Persischen Marsch» einen Orden verlieh und Musikschulen für westliche Instrumente gründete.
Auch im 20. Jahrhundert blieben die Kontakte zwischen den Welten eng und das gegenseitige Interesse gross. 1936 verbot der Schah Reza Pahlavi den Tschador, auch die Männer sollten europäische Hüte tragen. Das führte zu durchaus praktischen Problemen, wie die vom Orient zutiefst faszinierte Schweizer Schriftstellerin Annemarie Schwarzenbach in ihrem literarischen Reisebericht «Tod in Persien» schilderte: Bei der traditionellen Kopfbedeckung, so schrieb sie, hätten die Männer «den Schirm in den Nacken drehen und so beim Verrichten des Gebets vorschriftsmässig den Boden mit der Stirn berühren können, ohne das Haupt zu entblössen. Das war mit einem europäischen Filz, einem Strohhütchen, einer Melone schlechthin unmöglich – deshalb glaubten die Mullahs ihre Stunde gekommen (…).»
Diese Stunde kam erst gut vier Jahrzehnte später, mit der iranischen Revolution von 1979. Der Schah wurde abgesetzt, Ayatollah Ruhollah Chomeini übernahm die Macht. Das hatte weitreichende Folgen auch für die Musikszene – von denen Kian Soltani und Farzia Fallah einiges erzählen können.
Verbot der westlichen Musik
Zu den ersten Massnahmen der neuen Herrscher gehörte das Verbot von westlicher Musik. Das 1953 gegründete Philharmonische Orchester Teheran musste seinen Konzertbetrieb einstellen, die Musikschulen wurden geschlossen, viele Musiker*innen wanderten aus.
Khosro Soltani war schon früher gegangen, er war 1974 nach Wien gezogen und hatte die Dozenten an der dortigen Musikhochschule mit seinem Können verblüfft: «Mein Fagott-Dozent war völlig überrascht, dass wir im Orient über eine so ausgefeilte Spieltechnik verfügten», sagte er einst in einem Interview.
Spätestens nach der iranischen Revolution wurde Khosro Soltani zum Brückenbauer zwischen den musikalischen Welten. Er spielte Fagott und Flöte im Alte-Musik-Ensemble Les Menestrels, bei den Wiener Philharmonikern und in weiteren klassischen Orchestern; daneben gründete er das Ensemble Shiraz, mit dem er auf den traditionellen Blasinstrumenten Ney, Duduk und Sornay persische Musik aufführte.
Und er unterstützte seinen Sohn Kian Soltani, der mittlerweile als Cellist auf den internationalen Podien angekommen ist. In den kommenden Monaten wird er in der Tonhalle Zürich als Fokus-Künstler unter anderem die grossen Konzerte von Schumann und Schostakowitsch aufführen. Für einen Auftritt mit seinem Vater und dem Ensemble Shiraz wechselt er aber auch zur Kemantsche, einer persischen Stachelgeige. In seiner Kindheit habe bei Festen oft die ganze Familie musiziert, sagt Kian Soltani. Das hinterliess Spuren auch in seinen klassischen Interpretationen: etwa in orientalisch inspirierten Verzierungen, die er gelegentlich in seinen Kadenzen verwendet. (Mehr zu Kian Soltani erfahren Sie im Podcast Intro mit ihm).
Eine Ingenieurin wird Komponistin
Eine ganz andere Geschichte hat die Komponistin Farzia Fallah erlebt. Sie wurde 1980 in Teheran geboren und wuchs dort während des Golfkriegs auf. Konzerte waren damals kein Thema, «es ging ums Überleben», sagt sie am Telefon. Nur die Literatur, die in der persischen Kultur eine grosse Rolle spielt, war auch während des Kriegs präsent, «meine Generation ist deshalb noch stärker davon geprägt als andere». Und sie selbst als Tochter eines Dichters erst recht.
Sie sei in einem offenen Umfeld aufgewachsen, erzählt Farzia Fallah. Zu Hause hätten sie viel traditionelle iranische Musik gehört, aber als Teenager wollte sie Klavier spielen; so kam sie mit dem westlichen Repertoire in Berührung. Wegen ihrer Liebe zur Mathematik und Physik absolvierte sie dann ein Ingenieurstudium; daneben erhielt sie privat eine breite musikalische Ausbildung.
Und sie genoss das kulturelle Leben, das nach dem Krieg allmählich wieder erwachte. Farzia Fallah erinnert sich an Filme, die sie beeindruckten, «etwa jene von Tarkowski». Theater-Aufführungen und Konzerte fanden wieder statt. Selbst die Sängerinnen, die offiziell nach wie vor nicht solistisch auftreten durften, fanden inoffiziell zahlreiche Möglichkeiten dafür. «Für die begrenzte Infrastruktur, die es gab, war die Szene wirklich sehr aktiv», sagt die Komponistin. «Wir waren mit viel Eigeninitiative und Herzblut unterwegs.»
Die Beschaffung von Noten war bis zur Einführung des Internets zwar kompliziert, aber möglich. «Man konnte vielleicht nicht einfach in den Laden gehen und Ligetis ‹Préludes› kaufen. Aber vieles war da, und vor allem haben wir getauscht: Wenn einer eine besondere Partitur hatte, dann hatten sie danach alle.» Sie spricht oft von «wir», gerade im Bereich der zeitgenössischen Musik entstand damals eine eng verbundene Gemeinschaft um den Komponisten Alireza Mashayekhi, der lange in Europa und in den USA gelebt hatte, aber dann nach Teheran zurückkehrte: «Er wollte 1000 Komponistinnen und Komponisten ausbilden, weil er der Meinung war, dass die Lebendigkeit der Musikszene davon abhängt.»
«Mehr wissen, mehr kennen, mehr lernen»
Nach dem Abschluss ihres Ingenieursstudiums stand dann eine Entscheidung an, und Farzia Fallah entschied sich für die Musik. Ihre Antwort auf die Frage nach dem Grund verrät eine ganz eigene Logik: «Es gab viele grossartige Ingenieure im Iran, aber nicht so viele Komponistinnen, deshalb schien mir das wichtiger.» Und weil sie «mehr wissen, mehr kennen, mehr lernen» wollte, zog sie 2007 nach Deutschland, um bei den Komponist*innen Younghi Pagh-Paan, Jörg Birkenkötter und Johannes Schöllhorn zu studieren.
Sie sei damals nach Deutschland gereist mit der Idee, nach dem Studium wieder nach Teheran zurückzukehren, sagt sie, «aber ich war bald einmal in der freien Szene unterwegs und bin dann hängen geblieben». Heute lebt sie als freischaffende Komponistin in Köln und beobachtet die Entwicklungen in ihrer Heimat aus engagierter Distanz.
Ihre Werke kommen meist ohne Text aus, auch ohne konkrete Bezüge zu ihrer Heimat: «Ich verwende keine traditionellen Melodien oder Tonsysteme.» Ihre Klangsprache ist jene der westlichen Avantgarde; sie setzt auf hoch nuancierte Farben, die sich aus der Stille herauslösen. Ihre Herkunft spiegelt sich allenfalls in den auffallend poetisch formulierten Aufführungsanweisungen: «Sich in den ersten Klang einträumen und in dessen Nachklang spielen» heisst es etwa in der Partitur ihres Werks «im selben Augenblick».
In Zürich wird ihr Orchesterstück «Traces of a Burning Mass» aufgeführt, das zunächst einmal mit ihrer alten Liebe zur Physik zu tun hat. Der Titel bezieht sich auf die Sonne, «für mich ist es eine krasse Vorstellung, dass das, was unser Leben erlaubt, eigentlich eine brennende Masse ist». Aber auch Herzen können brennen, fügt sie dann noch hinzu, «für das, was wirklich wichtig ist». Mehr möchte sie nicht sagen dazu. Musik müsse frei sein: auch in der Deutung, die man ihr zuschreibt.