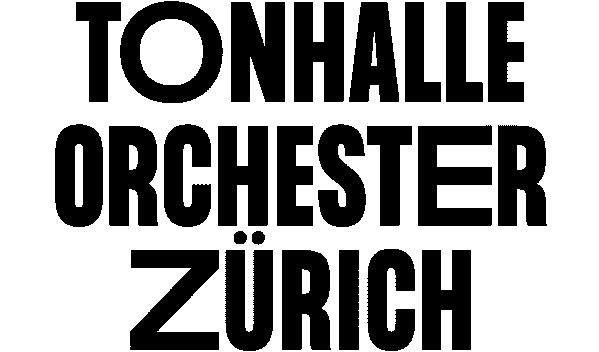Marie-Antoinette, eine Putzfrau und die Harfe
Keine Harfe ohne Engel? Die Schweizer Harfenistin Tjasha Gafner über Stereotypisierungen und die Frage, was eine französische Königin mit ihrem Instrument zu tun hat.
«Yes, I’m napping in my harp cover. Who else does that?» So berichtet die 25-jährige Tjasha Gafner selbstironisch auf ihrem Instagram-Kanal aus dem Tonstudio: Der zweite Tag der Aufnahme ihres neuen Albums sei anstrengend – da bietet sich die geräumige Hülle der Konzertharfe geradezu für einen kurzen Powernap an. Auch sonst präsentiert sie sich in den Sozialen Medien nahbar, authentisch und immer mit einer Prise Humor. Ab und zu lässt sie ihre Follower abstimmen, welche Harfe sie für ein bevorstehendes Rezital wählen soll. Damit die klanglichen Unterschiede besonders gut zu hören sind, spielt sie nacheinander denselben Ausschnitt auf den zwei zur Verfügung stehenden Instrumenten.
Musikalische Rundumsicht
Wie präsentiert man sich als Musikerin auf Social Media? Wie bildet man Netzwerke? Und welche Rolle spielt die Bühnenpräsenz? Solche Fragen wurden in ihrem Studium an der Juilliard School in New York diskutiert. «Die Musik stand zwar im Vordergrund, aber wir haben über den Tellerrand hinausgeschaut. » Die Unterschiede zu ihrer Zeit an der Haute École de Musique in Lausanne lägen vor allem in der Schulstruktur, weniger im Harfenunterricht. Sie konkretisiert: «In der Schweiz ging es nur um die Musik – in New York jedoch darum, wie du das Interesse deines Publikums weckst und dein Konzert bewirbst.»
Musik als Business und Selbstvermarktung zu sehen, klinge zunächst sehr wirtschaftlich und unpersönlich, sagt Tjasha Gafner. «Ich habe jedoch erkannt, welche Rolle diese Faktoren beim Aufbau einer Karriere spielen.» Das Menschliche kam trotzdem nie zu kurz – insbesondere in der Beziehung zu ihrer Dozentin Nancy Allen. In den Privatstunden hätten sie mehr geredet als an den Saiten gezupft. «Nancy hat immer gesagt: Ich bin deine Putzfrau. Eine sehr bescheidene Haltung. Damit meinte sie, wir seien alle schon Musiker*innen und wüssten, was wir wollen.» Anders formuliert: Für die Bereinigung technischer Schwierigkeiten stehe sie als «Putzfrau» jederzeit zur Verfügung. Ökonomisch ausgedrückt also ein «Bottom-up-Ansatz», bei dem die Studierenden genau wissen, was sie brauchen, um sich zu verbessern.
Mehr als ein Engel
Wenn Tjasha Gafner über ihre frühere Lausanner Harfenlehrerin Letizia Belmondo spricht, gerät sie ebenfalls ins Schwärmen. Neun Jahre lang erhielt sie bei ihr Unterricht. Sie sei für sie wie eine zweite Mutter, eine Schwester und eine Freundin zugleich gewesen – ein Vorbild in allen Bereichen. Belmondo ist Italienerin, «irgendwann begann ich, ihren Akzent zu übernehmen, weil ich wie sie sein wollte». Musiker*innen tragen viel dazu bei, wie ihr Instrument wahrgenommen wird. Da liegt die Vermutung nahe, dass durch die Imitation ihrer Mentorin in Tjasha Gafners Kopf eine Verbindungslinie zwischen Harfe und italienischem Akzent entstanden ist.
Stereotypisch betrachtet, existiert wohl eher eine Verbindungslinie zwischen Harfe und Engeln: Ein Glissando scheint uns direkt an das Himmelstor zu katapultieren. Ein solches Klischee wirkt einengend, aber Tjasha Gafner sieht darin auch eine Chance. Denn Harfenist*innen seien mitverantwortlich dafür, wie sie gesehen werden – man müsse nur die Zügel selbst in die Hand nehmen. Sich krampfhaft zu verstellen, um der Engel-Schubladisierung ein Ende zu setzen, komme jedoch nicht in Frage: «Ich bin mir bewusst, dass ich eine Harfenistin mit langen blonden Haaren bin. Aber ich ändere mich nicht, nur damit ich wie eine Rebellin wirke.» Vielmehr könne sie mit ihren Programmen versuchen, die Vielseitigkeit der Harfe aufzuzeigen.
Raum für Neues
Klavier-Repertoire ist in der Harfenwelt weitverbreitet, doch die Möglichkeiten der Instrumente sind nicht genau dieselben. Wenn man bei der Harfe das erste Pedal von links ganz nach unten drückt, erhält man ein Dis – und zwar gleich in jeder Oktave. In diesem Punkt lässt das Klavier mehr Freiheiten zu. «Genau da muss man neue Ideen entwickeln und wird kreativ», sagt Tjasha Gafner. Aktuell bearbeitet sie mit einer Flötistin Schostakowitschs Jazz-Suite. Auch wünscht sie sich eine Transkription von Ravels «Ma mère l’oye» für Klavier und Harfe.
20 Auszeichnungen hat sie innerhalb von zehn Jahren erhalten, darunter den 1. Preis im Fach Harfe des ARD-Musikwettbewerbs. «Die Zeit» hat sie ausserdem 2023 als eine der dreissig bedeutendsten Persönlichkeiten unter dreissig Jahren in Deutschland gewählt.
Influencerin des 18. Jahrhunderts
Rund 250 Jahre früher wäre diese Auszeichnung vielleicht an Marie-Antoinette gegangen. Auf einem Portràt von Gautier d‘Agoty aus dem Jahr 1777 ist sie in ihrem Salon im Schloss Versailles an einer vergoldeten Harfe zu sehen – umgeben von einer amüsierten kleinen Gesellschaft. Weil sie dieses Instrument spielte, wollten andere Adligen es ihr gleichtun. Tjasha Gafner formuliert es für unsere Zeit passend: «Marie-Antoinette machte die Harfe wieder trendy.» Man kann sie deshalb guten Gewissens als Influencerin des 18. Jahrhunderts bezeichnen.
Der französische Adel hat diesen Trend unterstützt und die Weiterentwicklung der Harfe – insbesondere die der Pedalmechanik – finanziert. Vorerst war das Instrument in den Wohnzimmern und Salons beheimatet. Es sei eigentlich nicht dafür gebaut, um irrsinnig laut gespielt zu werden, gibt Tjasha Gafner zu. Im Orchester geht es daher oftmals etwas unter: «Du siehst, dass die Harfenistin ihre Finger bewegt, hörst aber nichts.» Dies ist auch einer der Gründe, warum die Lausannerin Solistin und nicht Orchestermusikerin geworden ist. Ein Verstärker könnte hier je nach Bedarf Abhilfe schaffen, sagt sie.
In der Kleinen Tonhalle wird Tjasha Gafner diesen nicht brauchen: Sie tritt am 03. Februar 2025 zusammen mit ihrer besten Freundin, der Pianistin Aurore Grosclaude auf – und freut sich, wenn man neben dem Engelsbild Raum für Neues zulässt.