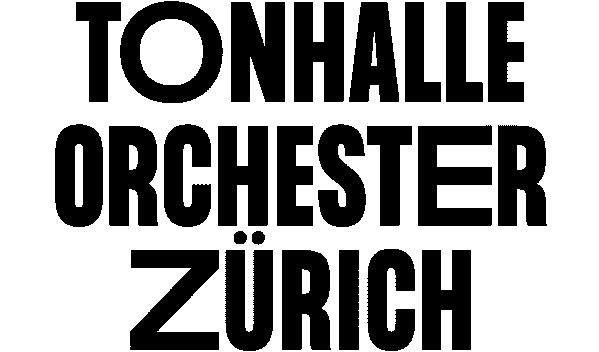«Beethoven und Mozart konnten eben nicht für uns komponieren»
Vivi Vassileva ist Schlagzeugerin – und damit auch Leistungssportlerin. Muskelkater und Hunger sind die ständigen Begleiter nach den Proben. Dank dieser Körperlichkeit findet sie zur inneren Mitte.
Ich stehe an einem Strand in Winterthur, der übersät ist von angespültem Treibgut. Chaotisch wirkt er dennoch nicht. Die Kaffeekapseln, Blumentöpfe, Flaschen, Pfannen und viele weitere Gegenstände scheinen nach einer inneren Logik geordnet zu sein. «Ich kenne wohl alle Blumentöpfe der Städte, in denen ich dieses Konzert gespielt habe», sagt die 1994 geborene Schlagzeugerin Vivi Vassileva vor ihrer Probe im Solistenzimmer. Sie bietet mir einen Kaffee an und erklärt, dass meine Kaffeekapsel nachher zum Einsatz käme. Wie bitte? Sofort starte ich die Kaffeemaschine.
Am nächsten Tag wird sie hier auf dem vermeintlichen Strand – der Bühne des Stadthauses Winterthur – das «Recycling Concerto» von Gregor A. Mayrhofer mit dem Musikkollegium Winterthur aufführen. Und sie hofft, dass bis dann keine «Instrumente» zu Bruch gehen: «Einen Blumentopf kannst du nicht nachstimmen. Man muss sich durch vier, fünf Geschäfte kämpfen, um den perfekten Ersatz zu finden.»
Aller Anfang am Strand
Dass die 30-jährige Vivi Vassileva Blumentöpfen Musik entlocken würde, hätten ihre Eltern zu Beginn sicherlich nicht vermutet. Ihr Vater und ihre Geschwister sind Geiger, die Mutter Pianistin. Mit acht Jahren befand sich Vivi Vassileva ebenfalls an einem Strand, an jenem der Schwarzmeerküste Bulgariens, ihrer Heimat. Hier beobachtete sie eine Gruppe Trommelspieler, die sich mit Balkan-Rhythmen austobte. Ihre Faszination war in diesem Moment so gross, dass sie unbedingt Schlagzeugerin werden wollte.
Als sie sich für Perkussion zu interessieren begann, habe ihre Familie sie manchmal veräppelt, erzählt sie lachend. So fielen etwa Sprüche wie: «Nicht die Hände müssen wehtun, sondern der Kopf.» Das treffe auf Schlagzeuger*innen aber nicht zu hundert Prozent zu. Bei der Probe in Winterthur beobachte ich, dass ihr Einsatz einem Ganzkörpertraining gleicht: Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit – nichts wird ausgelassen. Auch ihr Outfit passt dazu: Tanktop, zerrissene Jeans und Turnschuhe. Muskelkater? Ja, absolut, meint sie: «Wenn ich auf Röhrenglocken spiele, spüre ich auf jeder Seite alle Muskeln – vom Brustmuskel bis zum Trizeps und Bizeps. Nach einer Session muss ich auch dreimal mehr als sonst essen.»
Die anfängliche Skepsis der Eltern verflog spätestens dann, als die Marimba einzog: «In diesem Moment waren bei ihnen ebenfalls Neugier und Entdeckergeist geweckt.» Ihr Weg zur professionellen Schlagzeugerin begann schliesslich mit zehn Jahren bei Claudio Estay. Inzwischen kann Vivi Vassileva auf ihr abgeschlossenes Studium bei Martin Grubinger und auf zahlreiche Auszeichnungen zurückblicken – darunter der Leonard Bernstein Award 2023 und zwei Sonderpreise beim ARD-Musikwettbewerb 2014.
«Wir sind eigentlich Pioniere»
In Rockbands sind Schlagzeuger*innen längst eine Selbstverständlichkeit, in der klassischen Musik jedoch als Solist*innen noch nicht wirklich. Aufgekommen ist das Drumset erst an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, hauptsächlich durch den Jazz: «Beethoven und Mozart konnten eben für uns nicht komponieren. Das ist ein Grund, warum wir manchmal nicht ernst genommen werden.» Aber die «Jahrhundertlegende » Martin Grubinger war und ist der Wegbereiter für das Solo-Schlagzeug in der Welt der Klassik. Seine klanglichen und technischen Vorstellungen sowie die Schule, die er etabliert hat, hätten dem Schlagzeug einen «Vorsprung um Jahrzehnte» gegeben, sagt Vivi Vassileva.
«Wir sind eigentlich Pioniere. Wir schreiben Geschichte mit. Das ist so aufregend.» Dazu gehöre auch die Beratung von Komponist*innen. Eine grosse Verantwortung, «denn das sind die Stücke, die hoffentlich den Filter unserer Zeit überleben und in hundert Jahren noch so geschrieben stehen». Es ist unübersehbar: Vivi Vassileva hat Grosses vor – und da es noch viel zu entdecken und zu entwickeln gibt in dieser Welt des Solo- Schlagzeugs, hat sie für sich hier die ideale Spielwiese gefunden.
Ein Wermutstropfen aber bleibt: «Ich glaube, die grösste Tragödie für uns ist, dass Strawinsky nicht lange genug gelebt hat, um ein Schlagzeugkonzert zu schreiben.» Sie spielt auf ein spezifisches Werk an: «Nach wie vor ist sein ‹Sacre du printemps› rhythmisch der Mount Everest.» Schlagzeuger*innen träumen von einem Konzert, das musikalisch, rhythmisch und von der Orchestrierung her auf diesem Niveau ist. Bei der Ausdauer, die Vivi Vassileva in der Probe an den Tag legen muss, mutet man ihr zu, einen derart hohen Berg erklimmen zu können.
Der Atemhauch der Athene
Die Vibrationen einer Pauke im Orchester spüren nicht nur die Schlagzeuger*innen, sondern auch alle anderen Musiker*innen: «Wir haben diese Verantwortung, den ganzen Motor am Laufen zu halten.» Es geht hier durchaus um etwas Bedeutendes: «Wir stehen in einer Krieger-Haltung, damit wir diese Verbindung zur Erde spüren. Man kann nicht einer grossen Taiko begegnen und ihr mit Selbstbewusstsein gegenüberstehen, wenn man wacklig ist. Man braucht diese Stabilität. » Vivi Vassileva erklärt, dass beim Schlagzeug alle vier Elemente eine Rolle spielen: Dabei steht die Erde für die Verwurzelung mit dem Boden, das Feuer für die Leidenschaft beim Spielen, das Wasser für die Flexibilität (die Beherrschung vieler unterschiedlicher Schlaginstrumente) und die Luft für den Atem, den sie den Noten mit den Schlägen einhauche – ähnlich wie Athene es bei den aus Ton geformten Menschen machte.
Musikalische Kreislaufwirtschaft
Zurück in die Winterthurer Probe und zum «Recycling Concerto», das Mayrhofer eigens für Vivi Vassileva geschrieben hat. In der Pandemiezeit haben die beiden allerlei ausprobiert: Gelingt es, einem Salzstreuer oder einem Plastiksack einen Sound zu entlocken und funktioniert das im Gesamtwerk?
Eines stand fest: Plastik musste ganz sicher vertreten sein. Es macht den Müll zum Thema. Aber dabei bleibt es nicht: Das Konzert verarbeitet ihn weiter zu einer musikalischen Kreislaufwirtschaft. Und das Experimentieren hat sich gelohnt: «Die Plastikflaschenkadenz ist eine super Passage geworden und eine riesige Bereicherung für unsere Sololiteratur.» Es sei dieser enge Austausch zwischen Musiker*in und Komponist*in, der das Schlagzeug «aktueller denn je» mache.
Klimakrise oder globale Abfallproblematik – wie viel Raum soll man solchen Themen in der Kunst geben? So viel, dass die Ehrlichkeit Platz findet, antwortet Vivi Vassileva: «Kunst ist der Ausdruck der dringenden Fragen. Wir sehen den Klimawandel, den Müll, die Kriege und die vielen Herausforderungen. Niemand weiss, wie sich das entwickeln wird. Wenn wir als Künstler*innen ehrlich zu uns sind, ist es klar, dass solche Themen als Teil dieser Ehrlichkeit zum Ausdruck kommen.»
Diese Ehrlichkeit wird mir jetzt vor Augen geführt: Vivi Vassileva wirft im ersten Satz «The Happy Tsunami of Wealth» Kaffeekapseln auf die Marimba, und obwohl ich nicht weiss, welche meine war, ist sie hier irgendwo und trägt gerade zur Abfall-Überflutung bei.
Am 3. März 2025 wird sich die Kleine Tonhalle nicht in einen Strand verwandeln. Hier kommt eine andere Art der Ehrlichkeit auf die Bühne: In ihrem Programm «Face à Face» brechen Vivi Vassileva und Frank Dupree die Grenzen zwischen Schlagwerk und Klavier auf – mit Werken von Thierry Deleruyelle, Péter Eötvös oder John Psathas. Übrigens hat Frank Dupree ebenfalls eine intensive Schlagzeugausbildung hinter sich. Da verwundert es nicht, dass die beiden laut Vivi Vassileva energetisch «absolut auf einer Wellenlänge » sind.