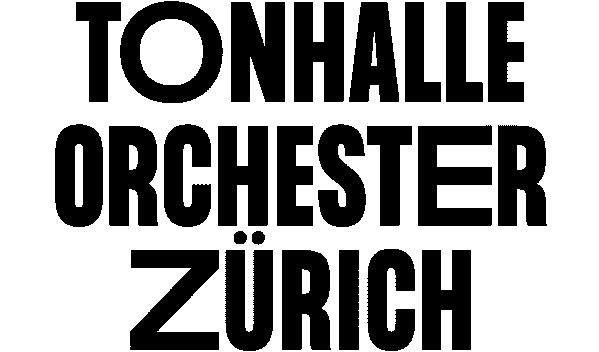«Es ist auch eine Frage der Chemie»
Jean-Christoph Hannig gehört zum Team, das die Konzertflügel in der Tonhalle Zürich stimmt und betreut. Er kennt nicht nur die Instrumente, sondern weiss auch, wie die Pianist*innen ticken.
Sie haben soeben einen Flügel gestimmt – und waren schneller fertig als vorgesehen. Warum?
Man weiss nie, wie lange man braucht. Es kommt auf viele Faktoren an: Wurde das Instrument länger nicht gespielt, gab es klimatische Wechsel, wurde es beim letzten Mal von jemand anderem eingerichtet …
Merken Sie, welcher Ihrer Kollegen das letzte Mal dran war?
Zum Glück kaum. Wir betreuen die Flügel in der Tonhalle Zürich in einem Viererteam von Musik Hug, und wir funktionieren so gut zusammen, dass ich in der Regel nicht sagen kann, wer den Flügel zuletzt gestimmt hat. Nur wenn einer von uns ein Instrument über längere Zeit ausschliesslich betreut, merkt man die Handschrift.
Worin zeigt sich denn ein eigener Stil?
Da muss ich ein bisschen ausholen: Im 19. Jahrhundert rissen die Saiten in den Flügeln oft, sie waren zu weich für den Zug, dem sie ausgesetzt sind. Ein Franz Liszt hat an einem Abend drei Flügel verschlissen. Also entwickelte man zähere Drähte; heute sind Klaviersaiten die härtesten industriell hergestellten Drähte überhaupt – wenn man im Baumarkt eine Kneifzange kauft, steht da drauf, wie dick der Klavierdraht ist, den sie kappen kann. Diese Härte hat nun aber klangliche Auswirkungen: Sie bewirkt, dass die Obertonreihe leicht gespreizt ist. Man kennt den Effekt von Glocken, da ist die Obertonreihe manchmal so weit gespreizt, dass unser Ohr den Klang gar nicht mehr als einzigen Ton wahrnimmt. Beim Klavier ist es weit weniger extrem, aber doch spürbar. Das bedeutet, dass ich bei der Stimmung die Intervalle ebenfalls leicht spreizen muss, damit es in sich rund ist. Wie weit man dabei geht: Das ist eine der Entscheidungen, die wir beim Einrichten des Instruments treffen müssen.
Gibt es Pianist*innen, die diesbezüglich Sonderwünsche anmelden?
Selten. Aber es gibt einige, die ihre eigenen Fachleute haben. Maurizio Pollini etwa ist seit Jahrzehnten mit demselben Stimmer unterwegs; auch András Schiff oder Hélène Grimaud arbeiten immer mit denselben Spezialisten. Das Einrichten eines Instruments ist nicht zuletzt eine Frage der Chemie: Auch bei uns kommt es vor, dass es einmal nicht so gut läuft mit jemandem; dann wird das nächste Mal ein anderer diesen Pianisten oder diese Pianistin betreuen.
Wie eng ist denn der Kontakt?
In der Regel hat man nicht viel miteinander zu tun. Wir stimmen vor jeder Probe und jedem Konzert, aber meist begegnen wir den Pianist*innen erst bei der Generalprobe. Dann kommt es vor, dass man am Instrument zusammen etwas anschaut – dieser Ton ist ein bisschen zu laut, jener zu scharf. Aber Wünsche im Vorfeld sind selten. Eine interessante Ausnahme war Víkingur Ólafsson in der letzten Saison. Er wollte unbedingt gewisse Funktionen sicherstellen, bei der Repetition, bei der Auslösung – und er hat das genau so angefragt, in unserer Fachsprache.
Das ist unüblich?
Ja. Es gibt zwar Musiker*innen, die sich wirklich befassen mit dem Klavierbau. Krystian Zimerman ist wohl das extremste Beispiel, er arbeitet selbst an seinen Instrumenten und stimmt sie auch. Auch Till Fellner oder Grigory Sokolov wissen genau, wie ein Flügel funktioniert. Aber die meisten kennen kaum mehr als die Verbindung Taste-Ton, und das ist manchmal ein Problem. Denn so können sie auch nicht benennen, was sie sich genau wünschen. Wenn dagegen ein Sokolov sagt, was er sich vorstellt: Dann ist das eine Herausforderung, das macht auch Spass.
Der erste Wunsch ist wohl der nach einem bestimmten Flügel. Wie gross ist die Auswahl in der Tonhalle Zürich?
In der Grossen Tonhalle haben wir zwei Instrumente, dazu ein weiteres in der Kleinen. Die sind nicht beliebig austauschbar, weil der Transport aufwändig ist. Das ist eigentlich schade, denn der Flügel aus dem kleinen Saal wäre eine wunderbare Ergänzung.
Wie würden Sie die beiden Instrumente im grossen Saal charakterisieren?
Vom Typ her sind beide gleich: Steinway-Konzertflügel, Modell D, 274 cm lang. Sie sind auch fast zur gleichen Zeit entstanden, vor rund 13 Jahren; aus der Seriennummer lässt sich ablesen, dass sie im Abstand von höchstens zwei Monaten gebaut wurden. Aber sie sind verschieden eingerichtet, das heisst: Die Hammerköpfe wurden ganz unterschiedlich bearbeitet. Der eine Flügel ist perkussiv, brillant; man braucht ihn für Werke mit grosser Besetzung, für solche, die viel Kraft und Klang verlangen. Der andere ist klassischer, ein bisschen zarter, auch leichter zu kontrollieren.
In welcher Hinsicht ist der brillante Flügel schwerer zu kontrollieren?
Er wird schnell so laut, dass es schwierig ist, die Klangfarben genau zu gestalten. Wobei es immer wieder Überraschungen gibt. Rudolf Buchbinder hat zum Beispiel sein «Diabelli-Project» auf diesem Flügel gespielt – und das war phasenweise sehr zart. Oder noch einmal Víkingur Ólafsson: Der brauchte diesen Flügel zwingend für das Konzert von John Adams. Er meinte dazu, der sei ja schon fast aggressiv, für Mozart hätte er ein Problem damit. Aber dann spielte er als Zugabe einen Satz aus einer Bach-Orgelsonate: Da hat er gezeigt, wie er diesen Flügel kontrollieren kann, welche Farben und Register er herauszuzaubern vermag. Da hörte man wirklich grosse Meisterschaft.
Wie sehr haben die Unterschiede mit der Einrichtung zu tun, wie sehr mit den Flügeln selbst?
Die Einrichtung ist entscheidend, aber es gibt schon auch Unterschiede bei den Instrumenten. So werden zum Beispiel die Fichtenhölzer für den Resonanzboden sehr rigoros ausgewählt. Trotzdem hat man bei den technischen Kennwerten Varianzen von bis zu 300 Prozent. Und das sind erst die Resonanzböden – vom Filz auf den Hammerköpfen wollen wir gar nicht reden, von der ganzen Handarbeit, die da dahintersteckt.
Aber es ist schon so, dass die klanglichen Unterschiede im Vergleich zu früher sehr viel geringer sind?
Ja – und ich persönlich bedauere das etwas. Das gilt nicht nur für die Steinways, auch alle anderen Hersteller haben sich diesem Klangideal angenähert. Wenn András Schiff seinen Bösendorfer in die Tonhalle Zürich mitbringt, hört man in den vorderen Reihen zwar noch einen Unterschied. Aber in der hinteren Hälfte des Saals ist der nicht mehr wahrnehmbar. Persönlich fände ich es schön, wenn es hier wieder ein Umdenken gäbe. Man hört in alten Aufnahmen, wie sehr sich ein Werk verwandelt, wenn es auf einem anderen Instrument gespielt wird.
Trotz der geringen Unterschiede testen viele mehrere Instrumente desselben Modells, bevor sie sich für eines entscheiden. Lohnt sich das?
Ja. Wenn wir für Musik Hug Instrumente einkaufen, fahren wir immer nach Hamburg in die Steinway-Manufaktur. Gerade kürzlich war ich wieder dort. Die waren sehr gespannt auf meine Wahl, als Techniker höre ich natürlich auf anderes als ein Musiker. Für mich ist vor allem entscheidend, dass ein Instrument gleichmässig ist. Und dann interessiert es mich, wie gut ich es allenfalls noch beeinflussen kann. Technisch ist es leichter, ein brillantes Instrument zurückzunehmen, als umgekehrt.
Warum?
Der Filz auf den Hammerköpfen wird unter hohem Druck und hoher Spannung um die Holzkerne gezogen und gepresst und verleimt. Am Anfang ist diese Konstruktion hart, man muss sie aufweichen, damit es überhaupt klingt. Wenn ich jetzt aber anfange, hineinzustechen, um das aufzuweichen, geht immer auch ein Stück der Elastizität verloren. Und die bringe ich nie wieder zurück.
Verändert sich ein Instrument mit den Jahren?
Ja. Wenn man es gut pflegt, kann es eigentlich ewig halten, die Qualität bleibt. Aber die Klangfarbe verändert sich. Ein älterer Resonanzboden entwickelt eine Wärme im Ton, die ein junger nicht hat. Andererseits behaupten manche, dass ein älteres Instrument nicht mehr dieselbe Dynamik entwickeln kann wie ein junges. Übrigens gibt es Pianisten, die sich gezielt junge Instrumente wünschen, zum Beispiel Grigory Sokolov. Wenn er in der Tonhalle Zürich auftritt, erhält er deshalb immer ein Leihinstrument von uns.
Wie pflegt man denn ein Instrument richtig, respektive: Welches sind die grössten Belastungen?
Das Schlimmste sind klimatische Wechsel, insbesondere Wechsel zwischen feuchter und trockener Luft. Deshalb sind auch häufige Transporte ein Stress für die Instrumente – wenn Pianisten wie Pollini oder Schiff mit ihren eigenen Flügeln herumreisen, ist das eine Belastung. Auch wenn man sie sehr oft unterschiedlich stimmt, tut das den Instrumenten nicht gut. Und wenn wir vom Spielen sprechen, dann ist die extremste Situation jene in einer Musikhochschule: Die Flügel, die fürs Üben freigegeben sind, sind fast rund um die Uhr im Einsatz. Da müssen die Hammerköpfe nach sechs bis sieben Jahren ersetzt werden.
Was gilt im privaten Bereich?
Auch hier sind klimatische Wechsel das grösste Problem. Ungünstig ist auch eine Bodenheizung, weil die Wärme von unten ins Instrument steigt, direkt an den klimatisch empfindlichen Resonanzboden. Ansonsten muss man vor allem schauen, dass man genügend Platz hat, nicht nur für das Instrument, sondern auch für den Klang. Wir erleben oft, dass Kunden sich einen Traum erfüllen und einen Flügel oder ein Klavier von Steinway kaufen. Beim Erstservice nach ein paar Wochen heisst es dann: Es ist alles wunderbar, aber könnten Sie das ein bisschen leiser machen?
Und, können Sie?
Ein bisschen etwas lässt sich durch die Einrichtung erreichen. Manchmal befestigen wir auch Schaumstoff zwischen den Balken unten am Flügel respektive hinten am Klavier. Aber das verändert natürlich auch den Klang. Ich verstehe deshalb nicht, warum es keine Klavierbauer gibt, die sich auf diese Nische spezialisieren: Das Interesse an leiseren Klavieren wäre bestimmt gross. Übrigens auch bei professionellen Pianisten: Konstantin Scherbakow zum Beispiel hat seinen Flügel wegen der Lautstärke verkauft. Er spielt zu Hause nun auf einem E-Piano.