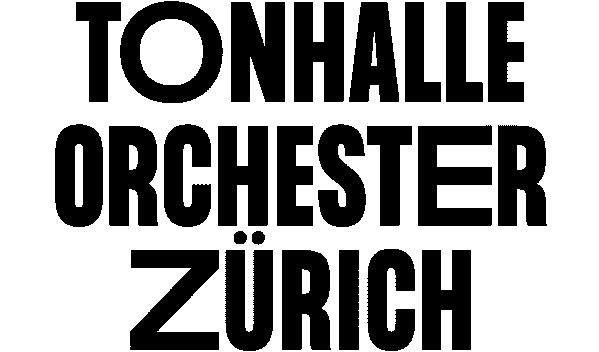Die Kurve klingt
Wo singen am meisten Menschen gemeinsam? Nein, nicht im Konzert – sondern im Fussballstadion!
Singen sie, oder singen sie nicht? Im Zusammenhang mit den Nationalhymnen, die nun bei der Fussball- Europameisterschaft wieder durch die Stadien dröhnen, hat sich die Frage zum Politikum entwickelt – spätestens seit 1984, als der kürzlich verstorbene Franz Beckenbauer seinen Mannen die aktive vokale Beteiligung an dem patriotischen Ritual verordnete. Je lauter die Spieler (und inzwischen auch Spielerinnen) singen, umso grösser ist ihre Identifikation mit dem Land: So lautet die einigermassen schiefe Gleichung, die auch in der Schweiz immer wieder für unschöne, teilweise offen xenophobe Abrechnungen sorgt. Und bei den TV-Übertragungen für Momente, in denen man das Gerät doch lieber auf stumm schaltet.
Singen sie, oder singen sie nicht? Bezieht man die Frage auf die Fans in den Kurven der Stadien, ist die Antwort weit erfreulicher und weniger kompliziert. Natürlich singen sie! Das war nicht immer so. Aber doch schon so lange, dass sich der Fangesang zu einer eigenen musikalischen Gattung entwickelt hat, über die mittlerweile historische, musikwissenschaftliche, literarische, psychologische, soziologische und kommunikationswissenschaftliche Studien geschrieben werden.
Wie das alles angefangen hat, darüber gibt es gleich mehrere Gründungsmythen. Der eine will es, dass im Liverpooler Anfield-Stadion 1963 mitten im Musical-Song «You'll Never Walk Alone» in der Version von Gerry and the Pacemakers die Tonanlage ausfiel, worauf die Fans eingesprungen seien und weitergesungen hätten. Eine Variante davon ist jene Geschichte, nach der damals immer vor dem Anstoss die Top-10-Hits gespielt worden seien; als «You'll Never Walk Alone» aus der Hitparade verdrängt wurde, hätten die Fans singend die Rückkehr des Songs gefordert. Und dann ist da noch die Geschichte vom Nebel, die vier Jahre später ebenfalls in Liverpool spielt: Dieser Nebel sei bei einem Spiel so dicht gewesen, dass man auf der einen Seite nicht sehen konnte, wer auf der anderen Seite ein Tor schoss. So rief die Kurve «Who scored the goal?» Und aus dem Nebel tönte es zurück: «Hateley scored the goal!»
Sicher ist dreierlei: Erstens, dass seit den 1960er-Jahren nirgendwo so herzhaft gesungen wird wie in den Fussballstadien – auch von Menschen, die das im «normalen» Leben nie tun würden. Zweitens, dass das antiphonale Prinzip von Gesang und Gegengesang, das bereits den gregorianischen Choral prägte, in diesem Rahmen bestens funktioniert. Und drittens, dass es keineswegs absehbar ist, was als Fangesang wirklich zündet: Der bis heute währende Erfolg des eher langsamen und nicht sonderlich ohrwurmtauglichen «You'll Never Walk Alone» ist das beste Beispiel dafür.
Reggae trifft Fussballmusik
Dass Fan-Hits manchmal einfach geschehen: Davon kann Elia Salomon im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied singen. Der 1986 geborene Zürcher, den man unter dem Namen Elijah Salomon als Reggae-Musiker kennt, war schon als Kind ein FCZ-Fan. Als Zwölfjähriger sah er bei der WM in Paris das Spiel Jamaika gegen Argentinien; der Sampler mit Songs über diese allererste Endrunden- Qualifikation der Jamaikaner war danach lange seine Lieblings-CD und doppelte Inspirationsquelle: für Reggae und für Fussballmusik.
Im Jahr 2013 kam in einem wehmütigen Moment beides zusammen. Das Fanlokal des FCZ, das in einer Garage in Wiedikon beheimatete «Studio Wellness», wurde geschlossen, und am Abend davor gab Elijah Salomon dort ein Konzert. Es sei kein guter Auftritt gewesen, erzählt er bei Gipfeli und Cappuccino, «die letzten Songs haben wir ziemlich verhauen». Das kann es nicht gewesen sein, dachte er nach dem Abgang von der Bühne, kehrte deshalb noch einmal zurück, stimmte auf der Gitarre die Akkorde an, die ihm ein paar Stunden früher auf dem Velo in den Sinn gekommen waren und sang dazu die Zeile «Nie usenand gah».
Der Funke sprang nicht nur aufs Publikum über, er wurde zur Stichflamme. «Eine Viertelstunde lang haben alle diese Melodie in der Endlosschlaufe gesungen», erzählt Elijah Salomon. «Ich habe dazu immer wieder neue Textversionen ausprobiert und mir jene gemerkt, die funktionierten » – auch dies durchaus nach dem musikhistorisch bedeutenden Prinzip der Antiphon. Am nächsten Tag spielte der FCZ in Thun, die ganze zweite Halbzeit sang die Kurve «Nie usenand gah». Seither ist das Lied die offizielle Hymne der FCZ-Fans; eine weiterentwickelte Version davon lieferte den Soundtrack für den Film zum 125-Jahr-Jubiläum des Vereins.
Es ist ein freundliches Lied. Niemand wird verhöhnt oder beleidigt darin, der Text kommt ganz ohne Kampfparolen, Chauvinismen, Kraftausdrücke und sonstige verbale Aggressionen aus. Da ist nichts, was den Negativ-Klischees von Fangesängen entsprechen würde. Es sei ihm darum gegangen, Emotionen zu vermitteln, sagt Elijah Salomon, vor allem jenes Gemeinschaftsgefühl, das für ihn zum positiven Fussballerlebnis gehört und selbst sportliche Baissen übersteht: «Wänns sii mues mit dir abe, nur zäme chömemer ue» heisst es im Lied, das zu einer Zeit entstanden ist, als der Abstieg eine durchaus realistische Perspektive war.
«Nie usenand gah» ist ein freundliches Lied. Niemand wird verhöhnt darin. Es geht um das Gemeinschaftsgefühl, das für Elijah Salomon zu einem positiven Fussballerlebnis gehört.
Mehr als grölen und johlen
Dieses Gemeinschaftsgefühl kennt auch Benjamin Nyffenegger, Stellvertretender Solo-Cellist im Tonhalle- Orchester Zürich. Er ist selbst begeisterter Fussballer im Dorfclub von Hunzenschwil, auch mit Orchesterkollegen spielt er regelmässig; auf der Asientournee im vergangenen Herbst haben sie sogar eigens Plätze gemietet, «es gibt nichts Besseres gegen den Jetlag, als Fussball zu spielen». Zudem ist er als treuer Fan des FC Basel oft in den Stadien unterwegs. Allerdings sitzt er nicht in der Fankurve, und er singt auch nicht, «oder höchstens, wenn mein Sohn dabei ist». Aber ohne die Fangesänge wäre es auch für ihn nicht dasselbe: «Fussball ist ja ein leises Spiel, da muss akustisch im Publikum schon etwas passieren.»
Was passiert, ist vielleicht nicht gerade Belcanto, aber doch weit mehr als grölen und johlen. So haben Untersuchungen gezeigt, dass die Songs mit ganz geringen Schwankungen stets in derselben Tonlage gesungen werden – als hätten die Stadien ein absolutes Gehör. Tatsächlich sei die Tonhöhe entscheidend, sagt Elijah Salomon: «Eine Zeit lang wurde 'Nie usenand gah' tiefer angestimmt, da war die Kraft sofort weg.»
Dass die Kraft von Fangesängen manchmal in Gewalt umschlägt: Davon hält Salomon rein gar nichts – nicht nur, weil er die Spiele inzwischen mit seinen Kindern besucht und von der Kurve auf die Tribüne gewechselt hat. Er mag auch nicht in die Klage einstimmen, dass die Atmosphäre in den Stadien wegen der mittlerweile sehr strikten Eingangskontrollen steifer geworden sei: «Die Sicherheit ist zentral. Und gerade in der Schweiz ist die musikalische Fankultur trotz der Massnahmen nach wie vor vibrierend.»
Auch Benjamin Nyffenegger schätzt die kreative Energie der Szene. Mit dumpfen Schlachtrufen kann er genau so wenig anfangen wie Elijah Salomon, «ich mag die witzigen Texte». Als Beispiel nennt er den britischen Humor, mit dem einst Zlatan Ibrahimović auf die Schippe genommen wurde: «His name is Zlatan, his nose is offside». Aber auch in der Schweiz schallt immer wieder Ironie aus den Kurven. Das beste Beispiel dafür findet sich wohl in der FCZ-Historie, in einem Rap-Song von Radio 200'000: «D'Kurve chläbt, d'Kurve chläbt, will de Präsi wieder mal es Bier usgleert hät. D'Kurve chläbt, d'Kurve chläbt, aber de Friisi bringt scho wieder es neus.» Dass damals zweifellos alle wussten, wer Friisi ist: Auch das gehört zur Fankultur, in der sich vieles um jene legendären Persönlichkeiten dreht, die während Jahrzehnten sozusagen zum Inventar der Stadien gehören.
Neues Leben für alte Songs
Zu dieser Stadion-Prominenz zählen auch jene, die dafür sorgen, dass die Kurve nicht nur klebt und lebt, sondern auch klingt. Da sind die Capos, die Vorsänger, die in bemerkenswerter Selbstaufopferung mit dem Rücken zum Spiel vor der Kurve stehen und den Ton angeben. Und da sind die Trommler, die für die rhythmische Basis zuständig sind. Viele seien wirkliche musikalische Talente, sagt Elijah Salomon: «Manche haben sich ihre Qualitäten im Stadion angeeignet, aber es gibt etliche, die auch daneben Musik machen.»
Vor allem aber kennen sie Musik: Auch das zeigen die Fangesänge, die zumeist Songs aus ganz anderen Zusammenhängen covern. Auf den Beatles-Hit «Yellow Submarine» passt der Text «Zieht den Bayern die Lederhosen aus». Aus «Go West» – geschrieben von den Village People, inspiriert von den Harmonien in Pachelbels berühmtem Kanon, zum Hit gemacht durch die Pet Shop Boys – wurde «Steht auf, wenn ihr Basler seid» (oder Berner, oder Schalker). Das Gitarrenriff aus «Seven Nation Army», das die White Stripes Bruckners Sinfonie Nr. 5 abgehört haben, hat sich in den Stadien weltweit verselbstständigt. Und auch «Nie usenand gah» ist ein Cover: Das Original mit dem Titel «'O Sarracino» hat in den 1950er-Jahren Renato Carosone gesungen; Elijah Salomon hat es als Kind zusammen mit seinem italienischen Grossvater gehört, «dank ihm habe ich die alten italienischen Schlager und Canzoni napoletane entdeckt».
Anders gesagt: In Sachen Urheberrecht wären Fussballgesänge ein Thema, an dem man sich die Zähne ausbeissen kann. Wer soll die Beiträge für noch gebührenpflichtige Melodien bezahlen? Sollen die Texter Tantiemen erhalten? Und was bedeutet es, wenn berühmte Claims dann auch auf Hoodies gestickt werden?
Eine SMS vom Goalie
Klar ist der Fall einzig bei jenen Songs, die nicht zufällig entstehen, sondern eigens komponiert und produziert werden. Da gibt es all die WM- und EM-Hymnen, die schon längst vergessen sind; abgesehen von «Un’estate italiana» von Gianna Nannini und Edoardo Bennato hat kaum eine den Stadiontauglichkeits-Test bestanden. Auch in der Schweiz wurden immer wieder Fussball-Lieder geschrieben, wobei sich die schönsten eher nicht dafür eignen, einen Verein zum Sieg zu pushen: Man denke nur an das wunderbar triste «Hüt hei sie wieder mau gwunne» der bekennenden YB-Fans Züri West.
Aber haben Fangesänge überhaupt eine Auswirkung aufs Spiel? Hören die Spieler die Songs? Ja, sagt Elijah Salomon, der am Tag nach jenem Thun-Spiel eine SMS vom damaligen FCZ-Goalie David Da Costa erhielt mit der Frage, was denn da gesungen worden sei. Ja, sagt auch Benjamin Nyffenegger: «Gerade gegen Ende eines Spiels, wenn noch etwas drinliegt, kann der Gesang vielleicht schon ein paar Energiereserven freisetzen.» Er vergleicht es mit dem Applaus im Konzert: «Wenn er enthusiastisch ist, überträgt sich das auf das Orchester.» Der Musikwissenschaftler Reinhard Kopiez, der eine «Fanomenologie» der Fussball-Fangesänge geschrieben hat, ist da skeptischer: Beim Dauerlauf könne die vokale Unterstützung durchaus helfen, hat er einst gegenüber der «Süddeutschen Zeitung» gesagt, «aber wenn Spieler komplizierte Situationen erkennen müssen, kann der Gesang sie stören».
Wie sehr die singenden Fans ihre Mannschaft beflügeln oder eben auch ablenken können, hängt nicht nur von ihren stimmlichen Reserven, sondern auch von den Stadien ab. Welches hat die beste Akustik? Für den FCZ-Fan Elijah Salomon ist es «sicher nicht der Letzigrund ». Die Bahn um das Spielfeld, das Holz im Dach, die offene Struktur – «all das sorgt dafür, dass man richtig viel tun muss, damit man etwas hört». Weit günstiger seien kompakte, steile Beton-Metall-Stadien: «In St. Gallen klingt es gut, auch in Genf, vielleicht noch in Luzern», findet er, und erinnert sich dann einigermassen wehmütig an ein Konzert mit seiner Band im längst abgerissenen Hardturm- Stadion: «Das war wohl die beste Akustik, in der wir überhaupt je gespielt haben.»
Dmitri Schostakowitsch, Schiedsrichter
Der Cellist Benjamin Nyffenegger würde auch noch den Basler St. Jakob-Park auf die Liste der guten Stadien setzen, «umso mehr, als sie die vor einigen Jahren eingebauten Dämpfer über der Fankurve wieder entfernt haben. Jetzt wird es wieder richtig laut». Noch besser war in seiner Erinnerung das alte Joggeli, wo er 1994 als Kind das Aufstiegsspiel des FC Basel erlebt hat, mit über 50'000 Leuten: «Das war absoluter Wahnsinn.»
Bleibt nur noch eine Frage: Schwappt dieser Wahnsinn in irgendeiner Weise vom Stadion in die Konzertsäle? Könnte sein, sagt Nyffenegger und erinnert an Dmitri Schostakowitsch, den wohl leidenschaftlichsten Fussballfan unter den grossen Komponisten. Schostakowitsch war ein treuer Anhänger des Vereins, der heute Zenit St. Petersburg heisst, pflegte engen Kontakt mit den Spielern, die er auch mal zu sich nach Hause einlud, und absolvierte sogar eine Schiedsrichterausbildung; gepfiffen hat er allerdings nur in den untersten Ligen. Ob es mit seinen Stadionerfahrungen zu tun hatte, dass er die Klangmassen in seinen Werken so wirkungsvoll aufladen, kanalisieren, explodieren lassen konnte – das müsste in einer weiteren Studie geklärt werden.
Aber eigentlich spielt es keine Rolle. Stadien wie Konzertsäle und Musikclubs sind eigene Welten mit eigenen Klängen; manche lieben alle, andere sind nur an einem Ort zu Hause. Wobei selbst Letztere bei einem Abstecher in fremde Gefilde einiges erleben könnten. So hätten Pachelbel, Bruckner & Co. zweifellos weiteres gutes Material für Kurven-Komponisten zu bieten. Und Benjamin Nyffenegger würde seine Orchester-Kolleginnen und -Kollegen gern einmal ins Stadion mitnehmen: «Ich bin sicher, das würde etwas auslösen.»
FC Tonhalle-Orchester
Nichts helfe besser gegen den Jetlag als Fussballspielen, sagt der Stellvertretende Solo-Cellist Benjamin Nyffenegger. Auf der Asien-Tournee im vergangenen Herbst haben er und einige gleichgesinnte Musiker deshalb gelegentlich Indoor-Plätze gemietet. Übrigens wird auch die Tonhalle Zürich gelegentlich zur Turnhalle: Wer tagsüber ins Vestibül kommt, erlebt dort unter Umständen ein Tischtennis-Turnier auf durchaus ansprechendem Niveau.