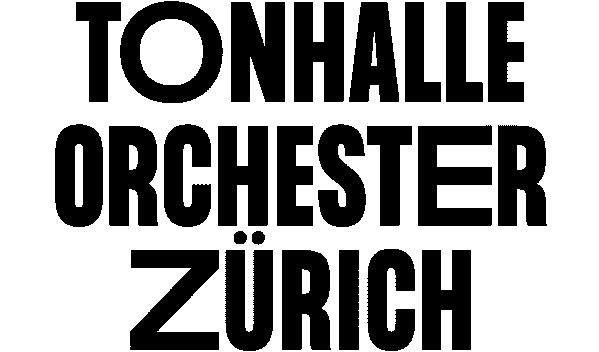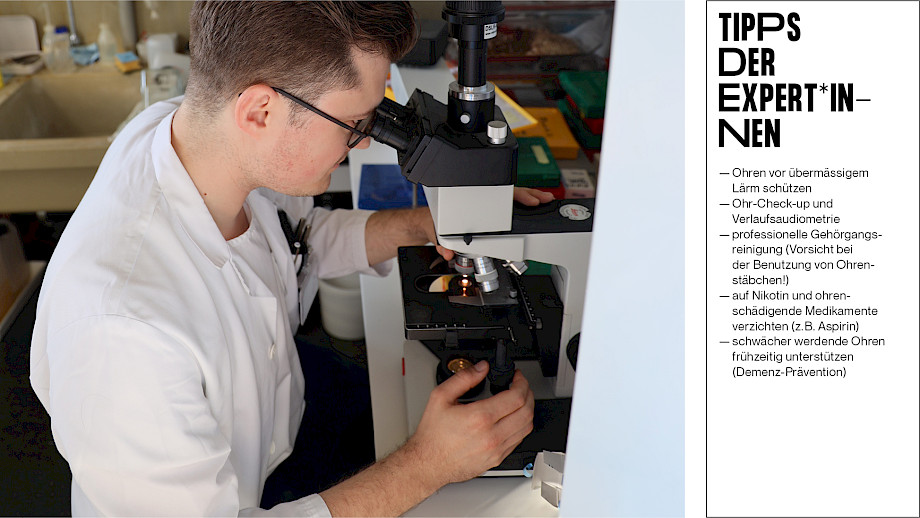Unser Ohr: Wie ein Klavier mit Tausenden von Tasten
Meistens gehen wir zu ihnen, wenn es schon zu spät ist, wenn die Ohren schmerzen, wie mit Watte gefüllt sind oder der Pfeifton nicht enden will: zu den HNO-Ärzten am Universitätsspital Zürich.
Auf dem Tisch begrüsst mich ein grosses Modell unseres Hörorgans und dahinter das freundliche Gesicht von Dr. med. Dr. sc. nat. David Bächinger. Er arbeitet als Arzt an der Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie am Universitätsspital Zürich und ist seit seinem Studium in Medizin und Biologie fasziniert vom menschlichen Ohr und davon, was es zu leisten imstande ist. Gemeinsam begeben wir uns auf eine kleine Reise in den menschlichen Gehörgang.
Auf zu Hammer, Amboss und Steigbügel
David Bächinger ist der kundige Reiseführer auf dem Weg von der Ohrmuschel, dem sichtbaren Teil des sogenannten äusseren Ohrs, in Richtung Kopfinneres. Als Teil des Mittelohrs, das uns allen bestens bekannt ist von der gleichnamigen Entzündung, ist das Trommelfell eine wichtige Wegmarke, denn es schliesst den Gehörgang luftdicht ab. Am Trommelfell befestigt sind die kleinsten Knöchelchen des Menschen: Hammer, Amboss und Steigbügel. Sie nehmen die Schwingungen aus der Luft auf und übertragen sie auf Flüssigkeiten im sogenannten Innenohr. Dieses besteht einerseits aus der Hörschnecke und andererseits aus dem Gleichgewichtsorgan. In der Hörschnecke, die tatsächlich aussieht wie ein kleines Schneckenhaus, passiert eine wichtige Übertragung: Winzige Haarzellen wandeln die mechanischen Schwingungen in elektrische Impulse um. Sie kodieren die Schallinformation, die dann über den Hörnerv in Richtung Hirn weitergegeben wird.
Ein Wunderwerk im Schneckenhaus
Über diese fragile Konstruktion im menschlichen Kopf gibt es dank der Forschung immer wieder neue Erkenntnisse, so Bächinger: «Was wir noch gar nicht so lange wissen: Die verletzlichste Stelle im Ohr ist die Verbindung zwischen der Nervenfaser und der Haarzelle, also quasi der Stecker dieses Kabels in die Haarzelle hinein. Und man weiss inzwischen, dass diese Strukturen schon bei deutlich tieferen Schallpegeln als die Haarzellen geschädigt werden. Das heisst, die Haarzellen verlieren dann einen Teil ihrer angehängten Nervenfasern, was dazu führt, dass komplexere Funktionen wie das Sprachverstehen eingeschränkt sind. Und man geht auch davon aus, dass Tinnitus dadurch verursacht werden kann.»
Zwischen dicht gedrängten Patiententerminen nimmt sich KD Dr. med. Dorothe Veraguth für uns Zeit; sie ist Leitende Ärztin in der Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie. Mit Blick auf die Forschung ist sie zuversichtlich, aber relativiert: «Diese Verbindungen zu den Haarzellen sowie die Haarzellen selbst können wir leider noch nicht ersetzen. Das wäre das grosse Ziel. Das wird aber sicher noch eine Weile dauern, trotz intensiver Forschung wären zehn Jahre zu kurz. Denn das Innenohr ist sehr komplex.» Wie komplex, erklärt sie anhand eines Vergleichs mit einem Instrument: «Jede Haarzelle hat die Aufgabe, genau eine Frequenz an Tönen oder an Klängen aufzunehmen und an den Hörnerv weiterzuleiten. Wir haben im Innenohr eine Art Klavier mit Tausenden von Tasten, die die Informationen sehr fein weitergeben. Und eine Tastatur mit Tausenden verschiedener Zellen exakt so wiederherzustellen, wie sie vorher war, jede einzelne Zelle für ihre Frequenz, das ist sehr anspruchsvoll.»
Daher kommt der Ratschlag der beiden Expert*innen auch nicht überraschend: Schützen ist besser als reparieren. «Wenn wir Musik geniessen möchten, dann müssen wir gut hören, damit wir wirklich alle Klänge und alle Frequenzen gut wahrnehmen können. Und das heisst, wir müssen unser Ohr möglichst gut vor übermässigem Lärm schützen, vor der Abnutzung der winzigen Haarzellen im Innenohr», so Dorothe Veraguth.
Schwerhörige Komponisten
Mit geschädigten Ohren hatten schon bedeutende Persönlichkeiten der Musikgeschichte zu kämpfen. Auch mit ihnen haben sich Dorothe Veraguth und David Bächinger in einem gemeinsamen Seminar mit Laurenz Lütteken vom Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Zürich genauer beschäftigt: Ihre Patienten waren diesmal Beethoven, Smetana und Schumann. Gerade bei Schumann ist die Auseinandersetzung mit Biografie und Werk von seinen Nervenleiden überschattet. Anhand von Beschreibungen aus Briefen, Schilderungen von Zeitgenossen und dem Haushaltsbuch mit Clara Schumann hat Bächinger den Umstand und dessen musikwissenschaftliche Bedeutung herausgearbeitet, dass Robert Schumann sehr früh an Schwindelanfällen litt und später auch an einem Tinnitus.
«Bis anhin wurden diese Beschwerden oft als psychische Erkrankung abgetan. Man muss aber nun davon ausgehen, dass vieles möglicherweise organisch bedingt ist, durch eine Erkrankung des Innenohrs. Denn von Schumann wissen wir, dass er vermutlich eine Syphilis- Erkrankung hatte. Und Syphilis ist berüchtigt dafür, dass sie gerade in den späteren Stadien auch ins Innenohr wandern und dort eine Erkrankung auslösen kann, die Schwindel, Tinnitus und einen Hörverlust verursacht.» Bei Schumann und anderen Komponisten hatten die Symptome durchaus Einfluss auf ihre Werke. So auch bei Smetana, der etwa 50 Jahre alt war, als er einen pfeifenden Tinnitus als Vorboten einer zunehmenden Hörminderung entwickelte. Auch bei ihm war wahrscheinlich eine Syphilis die Ursache. Aufgrund seiner Ertaubung zog er sich aus dem öffentlichen Leben zurück, komponierte aber weiterhin. In seinem ersten Streichquartett «Aus meinem Leben» verarbeitete er diesen Einschnitt: Im vierten Satz erklingt plötzlich ein langer, gellend hoher Ton – sein Tinnitus. «Quasi eine autobiografische Note in diesem späten ersten Streichquartett», so Bächinger.
Das berühmteste Beispiel ist wohl Beethoven, der schon mit etwa 30 Jahren erste Symptome der Schwerhörigkeit hatte: « ... nur meine ohren, die sausen und Brausen tag und Nacht fort», liess Beethoven 1801 einen Freund wissen. Er war auf Hörrohre angewiesen und ertaubte zunehmend. Dies hatte einen entscheidenden Einfluss auf sein Leben und nicht zuletzt Einfluss auf seine Wahrnehmung als Misanthrop. Andererseits gibt es nur deswegen als wertvolle Quelle die Konversationshefte, die uns einen sehr intimen Einblick in seinen Alltag geben. «Wenn man das genauer anschaut, findet man aber auch viele Zeugnisse, die Zweifel daran aufkommen lassen, ob er wirklich ganz so schlecht gehört hat wie oft beschrieben», erklärt David Bächinger. «So ist eine späte Begebenheit aus dem Jahr 1825 überliefert, zwei Jahre vor seinem Tod, dass eine Freundin von Beethoven einen Schrei ausgestossen habe, den er gut gehört und darüber gelacht haben soll. Aber dass Beethoven eine Schwerhörigkeit hatte, daran besteht kein Zweifel.»
Demenz-Prävention und Resilienz
Beethoven gab auch Ratschläge in Sachen Hör-Gesundheit: «Einem Wanderverkäufer gab er den Rat, dass Bäder und Landluft vieles verbessern könnten. Er hat auch davon abgeraten, allzu früh Hörgeräte zu gebrauchen, ‹Maschinen›, wie er das genannt hat, weil er dachte, dass er durch den Verzicht sein linkes Ohr ziemlich gut erhalten habe.» Doch dem letzten Teil dieser Empfehlung würden sich David Bächinger und Dorothe Veraguth heute keinesfalls mehr anschliessen. Im Gegenteil: Eine aktuelle Studie aus Grossbritannien, die im April 2023 publiziert wurde, zeigt, dass schlechtes Hören das Risiko für Demenz im Alter um 42 % erhöht. Das Tragen eines Hörgeräts hingegen hat das Risiko normalisiert. «Da werden die Untersuchungen noch weitergehen, wie genau die Zusammenhänge sind. Aber es ist ein wichtiges Signal, dass nur durch das Tragen eines Hörgeräts ein signifikanter Risikofaktor entfällt. Hörgeräte-Akustiker sind für uns wichtige Partner, wenn es um die weitere Betreuung nach einer akuten Behandlung geht. Da hat sich in den letzten Jahren enorm viel getan», betont Dorothe Veraguth.
Wie klingt Musik mit Hörgerät?
Wir haben den Zürcher Hörakustiker Michael Stückelberger befragt. Er kennt die Antwort aus eigener Erfahrung: Ein Hörverlust hat ihn vor rund 20 Jahren zu seinem heutigen Beruf gebracht.
Wie verändern Hörgeräte die Wahrnehmung des Orchesterklangs?
Hörgeräte sind extrem ausgerichtet auf das Sprachverstehen. Sie nutzen eine Vielzahl von Algorithmen, um akustische Signale zu optimieren. Einige davon können leider dazu führen, dass bei Musik Obertöne verändert werden oder dass man ein Tremolo hört, obwohl keines gespielt wird. Das ist natürlich störend. Hörgeräte arbeiten zudem mit Dynamikkompression. Leises wird überproportional verstärkt, Lautes wenig oder gar nicht, weil es sonst unerträglich laut würde. Damit wird das dynamische Spektrum der Musik reduziert, sie klingt flacher – ähnlich wie bei Tonaufnahmen, die ebenfalls mit Dynamikkompression arbeiten.
Kann man ein Konzert mit nachlassendem Gehör auch ohne Hörgerät geniessen?
Unbedingt! Hörgeräte werden ja nicht primär für Musik gekauft. Man braucht sie, um im Dialog, in Gesellschaft oder im Theater den Sinnzusammenhang nicht zu verlieren. In einem Sinfonie-Konzert ist es zwar schade, wenn man mit einem milden Hörverlust eine Pianissimo-Stelle nicht mehr hört. Aber die Musik als Ganzes «funktioniert» dennoch, denn sie wird ganz anders wahrgenommen als Sprache. Das gesprochene Wort muss vom Ohr korrekt gehört und dann im Gehirn interpretiert und zu sinnvoller Information verarbeitet werden. Musik braucht das nicht, Musik geht auf direktem Weg in unser emotionales Zentrum. Deshalb berührt sie uns ja auch so intensiv.
Auch andere Studien im Bereich des Hörens und speziell des Musikhörens haben in den letzten Jahren bemerkenswerte Erkenntnisse geliefert. So ergab eine internationale Studie des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main, dass Musik die Resilienz in Krisenzeiten stärkt – hier am Beispiel des Corona-Lockdowns. Die Direktorin des Forschungsinstituts, Melanie Wald-Fuhrmann, hebt hervor, dass «Musikhören und Musikmachen dabei unterschiedliche Bewältigungspotenziale » bieten. Diese Verarbeitungsmöglichkeiten umfassen drei grössere Bereiche: Musikhören «zur Regulierung von Depressionen, Angst und Stress», Musikhören und aktives Musizieren «als Ersatz für soziale Interaktionen » und «für ein Gefühl der Zugehörigkeit und Gemeinschaft » sowie Musizieren «als Mittel zur Selbstreflexion».
Professionelle Ohren
Diese Wirkung von Musik erleben auch Dorothe Veraguth und David Bächinger gerne im Konzertsaal. Beide haben eine besondere Verbindung zu klassischer Musik – sie spielte während des Studiums selbst Fagott, er setzt sich bis heute gerne ans Klavier. «Ich glaube, wenn man live in einem Konzert sitzt, ist man einfach wirklich vollumfänglich dabei: mit den Ohren, mit dem Augensinn, und man spürt auch die Stimmungen im Orchester wie im Publikum. Das heisst, alle Sinne sind mit dabei», so Veraguth. «Das sind die Momente, in denen wir selbst auch einfach entspannt oder gespannt lauschen und nicht an die komplexen Abläufe im Innenohr denken», ergänzt Bächinger mit einem Schmunzeln. «Nur manchmal zucke ich bei einigen Fortissimo-Stellen schon zusammen.»
Denn auch der Schutz von «Profi-Ohren» ist für Dorothe Veraguth und David Bächinger ein grosses Anliegen. Sie wollen einerseits den Begriff der «Professional Ear User» («PEU») in ihrem Fachbereich etablieren, gewissermassen als Pendant zu den «Professional Voice Usern», für die es bereits Konzepte in Sachen Prävention, Diagnostik und Therapie gibt. Andererseits arbeiten sie daran, ihr Konzept einer ganzheitlichen Ohrgesundheit in der Praxis zu verankern. So gibt es seit ungefähr zwei Jahren eine spezialisierte ohrenärztliche Anlaufstelle für «PEU» und – in Kooperation mit der Zürcher Hochschule der Künste – regelmässige Seminare, in denen bereits jungen Musiker*innen und Musikpädagog*innen, Komponist*innen oder Tonmeister*innen elementares Wissen rund um das Ohr vermittelt wird. Zum Kreis der «PEU» zählt Bächinger aber auch Berufsgruppen ohne Bezug zu Musik, wie Logopäd*innen, Ornitholog*innen oder Sonar-Techniker*innen – zusammengefasst all jene Menschen, die über eine «erlernte, überdurchschnittliche auditive Wahrnehmungsfähigkeit» verfügen. Für sie sind gesunde Ohren nicht nur wichtig, sondern eine Berufsgrundlage – möglichst mit allen Tausenden von «Tasten» im Innenohr.