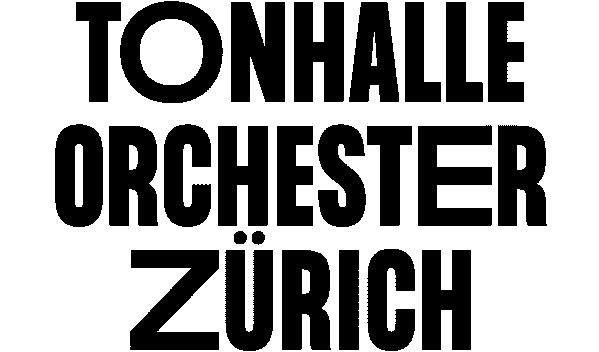Am liebsten sind ihr Wasser und Musik
Julia Becker ist Konzertmeisterin des Tonhalle-Orchesters Zürich. Dass ihr Vater ihr ein mächtiges Instrument mit auf den Weg gegeben hat, ist ihr im Corona-Lockdown klargeworden. Sie kann mühelos zur Leistung gelangen, zu der sie sich verpflichtet fühlt.
Ruhig und konzentriert sitzt Julia Becker auf der Bühne. Sie spielt sich auf ihrer Stradivari ein. Heute wird sich niemand neben sie setzen, wegen dem erforderten Abstand, den die Coronapandemie dem Orchester in diesen Wochen abverlangt. Ein paar weiträumig angeordnete Notenpulte, vielleicht drei Dutzend, an jedem wird nur eine Person spielen. Es ist Dienstag um zehn Uhr morgens in der Tonhalle Maag, gleich kommt Paavo Järvi, der gestern mit der erstmöglichen Maschine aus London angereist ist nach dem Lockdown. Julia ist Konzertmeisterin in diesen ersten öffentlichen Konzerten nach der langen Pause fernab der Bühne. «Ein paar Leute spielen für meinen Geschmack zu lang, bitte Viertel mit Punkt kürzer», sagt sie in die Runde. Heute sind es Streicherinnen und Streicher, die sie zusammenhält, grosse Besetzungen dürfen noch nicht spielen. Stricharten, Phrasierungen: Die Musikerinnen und Musiker verständigen sich untereinander und bringen Notizen im Notentext gemäss Julias Angaben an.
Zuhause am See
Als sie 1995 zum Tonhalle-Orchester Zürich hinzukam, war sie die erste weibliche Konzertmeisterin des Orchesters und eine der ganz Wenigen überhaupt. Sie teilt sich derzeit ihre Position mit Klaidi Sahatçi und Andreas Janke. Die Kolleginnen und Kollegen bewundern Julia: Sie komme, liefere Topleistungen ab, dann gehe sie wieder. Während Konzertwochen steigt sie seit 25 Jahren montags in aller Früh ins Auto in Utting am Ammersee bei München und fährt nach Küsnacht, wo sie bei einer Freundin eingemietet ist. Dann radelt sie in die Tonhalle Maag, bezieht ihr Konzertmeisterinnenzimmer und übt. Oder probt. Oder gibt Konzerte. Wenn der letzte Klang verklungen ist, verstaut sie ihre Geige auf dem Rücksitz und fährt zurück: 300 Kilometer, das Adrenalin des Konzerts fährt mit. Daheim erst löst sich die Anspannung von der Verantwortung. Julias zehnjähriger Junge schläft. Die beiden älteren Kinder, erwachsen, wohl auch. Ihr Mann, Hornist im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, erwartet sie mit einem Glas Weisswein und teilt mit ihr die Ereignisse der Woche.
Während des Lockdowns hat die Familie den sehnlichen Wunsch von Julias Jüngstem erfüllt: Ein Hundebaby namens Frieda. Frieda musste von Beginn weg zur Seetauglichkeit erzogen werden, das neue Zuhause des Tiers liegt direkt am See und Julias Mann segelt leidenschaftlich gern seit Kindesalter: «Von ihm habe ich mich gerne begeistern lassen», sagt sie, selbst seit vielen Jahren Besitzerin des Segelscheins. Segeltörns in Kroatien und in der Türkei und in aller Herren Länder sind seither das Programm während der Orchesterferien. Frieda hat inzwischen eine Nische im Cockpit gefunden und eine unter dem Flügel, Wasser und Musik sind ihr Zuhause wie das ihrer Herrin.
Neun von zehn in Sachen Ehrgeiz
«Üben ohne Ziel, das war für mich in dieser Zeit der schwierigste Teil», sagt Julia, dankbar, dass sie und ihre Liebsten gesund durch die drei Monate gekommen sind. Eigentlich habe sie nie sonderlich viel geübt: Im Alter von sechs Jahren wurde sie von ihrem Vater, selbst Geiger, unterrichtet. «Ihm habe ich so viel zu verdanken. Und auch der Engelsgeduld meiner Mutter» – der Vater hat ihr von Beginn weg gezeigt, was richtig üben heisst, das habe ihr viel Zeit erspart. Er war einer der ersten Schüler von Igor Ozim, der sich als Talentschmiede erwies, neben anderen prominenten Schülern haben auch Andreas Janke und Julia bei ihm studiert. «Von Papa kannte ich seine Schule bereits.» Und der Vater war wohl erleichtert, seine begabte Tochter in guten Händen zu wissen, sie nämlich fand gemäss eigenen Angaben mit elf, dass sie längst besser spielen würde. Julias Mutter indessen vermittelte, wenn die Tochter wieder einmal die Nerven verlor und am liebsten die Geige aus dem Fenster geworfen hätte, wenn der Vater sie zum Üben motivieren, sie aber viel lieber zum Sport oder ihre Freunde treffen wollte. «Einmal mit zwölf habe ich das Instrument aus Wut mit schwarzem Edding bemalt», sagt sie und schüttelt lachend den Kopf. Zwar sei sie noch heute, 51, keine fleissige Überin, wenn ihr das Ziel vor Augen fehle. Aber wenn es draufankomme, dann wisse sie um ihre Verantwortung: Bei Orchesterprojekten zum Beispiel. Viel geübt hat sie auch für ihr Solistendiplom, das sie, bereits Konzertmeisterin, 2004 bei Nora Chastain an der Zürcher Hochschule der Künste mit Tschaikowskys Violinkonzert abschloss. Das ambitionierteste Projekt aber setzte sie mit dem Jugendsinfonieorchester unter ihrem Kollegen David Bruchez-Lalli um: Das Violinkonzert von Aram Khachaturian, «etwas vom technisch Anspruchsvollsten auf der Geige, zudem unheimlich lang.» Ehrgeiz? «Neun Punkte auf einer Skala von zehn.»
Freitag, mittags um zwölf. Nun gilt es ernst: 240 anstelle von über 1200 Menschen haben sich als loses Schachbrettmuster im Publikum eingefunden, viele haben sich entschieden, Schutzmasken zu tragen. Sibelius: «Rakastava». Der Liebende. Julias Stradivari strahlt. Seidig legt sich ihr Klang über den Saal, um sich im nächsten Moment spurlos ins satte Ganze einzuweben. Dann Dvořák. Später wird sie ins Mikrofon einer Journalistin sagen, dass sie sich auf der Bühne selten so nah am Wasser gefühlt habe.