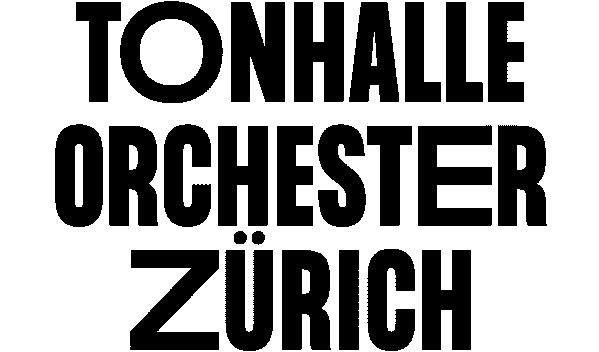"Somehow it clicked"
Austrian conductor Franz Welser-Möst has spent a significant part of his career in Switzerland. Now he is returning to the Tonhalle - among other things with music that he once also presented at Zurich Opera House.
Franz Welser-Möst, können Sie sich an das allererste Konzert erinnern, das Sie in der Schweiz dirigiert haben?
Das war Mitte der 1980er-Jahre in Schaffhausen, in der Kirche St. Johann, mit dem Musikkollegium Winterthur. Wolfgang Schneiderhan war der Solist in Beethovens Violinkonzert; was sonst noch auf dem Programm stand, weiss ich nicht mehr. Wenig später habe ich übrigens auch mein Debüt beim Tonhalle-Orchester Zürich gegeben, aber das ging gar nicht gut. Sie haben mich danach verständlicherweise nicht mehr eingeladen. Ich war zu jung, zu unerfahren.
Aber beim Musikkollegium Winterthur hat es funktioniert – Sie wurden dort ab 1987 für drei Jahre Chefdirigent, mit 27 Jahren. Kann man sagen, dass Ihre Karriere in der Schweiz begonnen hat?
Ich war damals gleichzeitig auch Chefdirigent im schwedischen Norrköping, da hatte ich sogar ein Jahr davor begonnen. Doch Winterthur war schon sehr wichtig, es war eine produktive Zeit. Das Orchester war engagiert, ich konnte vieles ausprobieren. Und man hat mir ein winziges, aber wirklich idyllisches Häuschen im Rosengarten zur Verfügung gestellt.
Wie haben Sie damals die Schweiz erlebt?
Zunächst einmal habe ich kein Wort verstanden, wenn Schwyzerdütsch gesprochen wurde. Ich dachte: Was reden denn die? Ich habe mich aber schnell daran gewöhnt.
Winterthur war damals sowohl konservativ als auch offen. Das Musikkollegium war noch privat organisiert, durch die Reinhart-Brüder. Wenn der Vorstand zusammenkam, dann waren das lauter Bürger der Stadt. So etwas kannte ich aus Österreich nicht, dort war schon seit Jahrzehnten alles von der öffentlichen Hand finanziert.
Gab es Klischees, die sich bestätigt haben? Oder eben gerade nicht?
Ich hatte wenig Ahnung von der Schweiz, als ich hier ankam. In Österreich kannte man Schweizer Schokolade und Schweizer Uhren, aus der Schule erinnerte ich mich an den Rütlischwur und die Geschichte mit den Habsburgern – mehr war da nicht. Was mich überrascht hat, war die Eigenständigkeit der Leute hier, dass die einzelnen Bürger wirklich etwas zählen und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung sehr bewusst sind. In Österreich wählt man alle paar Jahre, und das wars dann. In der Schweiz kann man dauernd abstimmen, und viele tun das auch. So etwas prägt die Mentalität schon. Ich habe die Schweizer als selbstbewusstes Volk kennengelernt.
Ihr zweites Schweizer Kapitel begann dann 1995. Da waren Sie 35 Jahre alt und wurden Chefdirigent am Opernhaus Zürich.
Das war wohl die wichtigste Station in meinem Dirigentenleben überhaupt. Die Oper war nicht zuletzt durch die Erzählungen meiner Mutter in der Familie immer sehr präsent gewesen. Als Studentin in Wien hatte sie auf dem Stehplatz etwa den «Rosenkavalier» mit Elisabeth Schwarzkopf gehört, das war ein sehr prägendes Erlebnis für sie. Ich war stets fasziniert von dieser Opernwelt und wollte da unbedingt hinein. Zürich hat mir dies dann ermöglicht.
Wie kamen Sie denn nach Zürich?
Meine Frau und ich besuchten eine Aufführung im Opernhaus, das war Anfang der 1990er-Jahre, Alexander Pereira hatte als Direktor gerade angefangen. In der Pause traf ich ihn zufällig, nachdem ich ihn jahrelang nicht gesehen hatte, und er meinte gleich: Sie müssen bei uns dirigieren. Bereits am Tag danach rief er an und schlug mir eine Wiederaufnahme des «Rosenkavalier» vor. Und weil ich zufällig ein Loch im Kalender hatte, kam das zustande. Ich erinnere mich noch an den furchtbaren Proberaum im Keller, den es damals gab.
Aber die Proben waren gut?
Irgendwie hat es Klick gemacht. Der Solo-Cellist Claudius Herrmann, mit dem ich immer noch in Kontakt bin, hat mir viel später einmal erzählt, dass das Orchester sofort anders geklungen habe. Und der andere Solo-Cellist, Luciano Pezzani, sagte als Präsident des Orchestervorstands zu Pereira, dass sie mich als Chefdirigenten wollten. So kam das. Wobei mir damals nicht klar war, worauf ich mich einliess, weil ich Pereira noch nicht so gut kannte.
Worauf liessen Sie sich denn ein?
Es war alles unglaublich intensiv! Ein Beispiel: Einmal habe ich in den ersten acht Tagen nach der Sommerpause vier Proben für ein Sinfoniekonzert mit der Achten von Bruckner dirigiert, eine vierstündige Hauptprobe und zwei Vorstellungen der «Lulu», die vor dem Sommer Premiere gehabt hatte, dazu zwei Mal die «Traviata» ohne Probe sowie Sängerproben für «Werther» und «Rheingold». Man musste in dem Haus extrem gut vorbereitet sein, weil man danach absolut keine Zeit mehr hatte. Es gab Spielzeiten, in denen ich 70 Vorstellungen geleitet habe, darunter fünf Premieren!
Insgesamt waren es dann in 13 Jahren rund 500 Aufführungen und 42 Premieren. Das sind imposante Zahlen.
Es war viel Arbeit in einer glücklichen Konstellation. Das Orchester der Oper war nach der Trennung vom Tonhalle-Orchester 1985 ein wenig führungslos, es hatte noch keine eigene Identität gefunden. Und ich konnte wahnsinnig viel lernen, auch von den Sängerinnen und Sängern: Ich bin unendlich dankbar, dass ich noch mit Künstlern und Künstlerinnen wie Nicolai Ghiaurov oder Mirella Freni zusammenarbeiten konnte. Wenn etwa Ghiaurov und Matti Salminen gemeinsam in der Oper «Boris Godunow» auftraten, brauchten sie nur dazustehen – und die Bühne war schon zu klein für diese Persönlichkeiten. Auch bei den Jungen war viel los, beim Tamino wussten wir zum Beispiel nicht, ob wir ihn jetzt mit Jonas Kaufmann oder mit Piotr Beczała besetzen sollten, die beide am Haus waren. Das muss man sich mal vorstellen!
Sie kommen ins Schwärmen …
Es war wirklich eine sehr spannende, intensive, lehrreiche Zeit. Es gab auch emotional sehr starke Bindungen zwischen mir und dem Orchester, mit der Studienleiterin und den Korrepetitoren, mit dem ganzen Team. Natürlich haben wir alle gejammert, dass es zu viel sei. Aber Pereira hat immer gesagt: «Wenn Sie keine Zeit haben, in der Kantine zu sitzen, dann intrigieren Sie auch nicht.» Das hat etwas Wahres; wir waren alle so beschäftigt, dass gar keine Zeit blieb für die üblichen Opernintrigen.
«Als ich nach Zürich ging, wurde ich ‹gewarnt›, dass man es mit Pereira nicht lange aushalten würde. Wir haben uns tatsächlich viel gezofft, doch es ging sehr gut und war sehr bereichernd, weil er so opernverrückt ist.»
Was haben Sie von Zürich ausserhalb des Opernhauses mitbekommen?
Wir wurden in der Gesellschaft hier sehr warmherzig aufgenommen. Da waren etwa die Opernhaus-Verwaltungsrätin und -Gönnerin Margot Bodmer und ihre Familie, die rasch sehr gute Freunde von uns wurden. In ihrer Stadtwohnung in der Storchengasse konnte ich immer übernachten, das war fantastisch – sehr ruhig, man konnte alles zu Fuss erledigen. Über sie habe ich auch viele andere kennengelernt. Den Historiker Conrad Ulrich zum Beispiel, der ein grosser Kunstliebhaber war; wir haben uns jeden Donnerstag über Mittag im Restaurant Orsini getroffen und über Opern gesprochen. Ich habe mich wirklich wohl gefühlt in der Stadt.
Die letzten Jahre waren aber schwierig, oder nicht? Es gab damals einige Reibereien mit Pereira …
Als ich nach Zürich ging, wurde ich «gewarnt», dass man es mit Pereira nicht lange aushalten würde. Wir haben uns tatsächlich viel gezofft, doch es ging sehr gut und war sehr bereichernd, weil er so opernverrückt ist. In den letzten Jahren schien er mir dann nicht mehr ganz so engagiert, und da regt man sich über Kleinigkeiten auf, bei denen man im Nachhinein denkt: Es war ja gar nicht so schlimm. Aber es war dann auch gut, nach 13 Jahren Abschied zu nehmen.
Inzwischen dirigieren Sie wieder regelmässig in Zürich – aber in der Tonhalle.
Das hat mit dem Solo-Schlagzeuger Klaus Schwärzler zu tun, der ein enger Freund von mir ist. Er spielte zuerst im Orchester der Oper, wechselte dann ins Tonhalle-Orchester und hat immer gesagt: Du musst mal kommen. Irgendwann war es so weit, und es hat gleich so gut geklappt, dass ich das Orchester nun jedes Jahr dirigiere.
Den Saal kennen Sie ja seit langem – wie derzeit wieder fanden auch schon früher die Philharmonischen Konzerte des Orchesters der Oper hier statt.
Genau – die erwähnte Bruckner-Sinfonie Nr. 8 haben wir zum Beispiel hier gespielt, das war massiv ...
Sie haben dieses Werk auch in der Tonhalle Maag dirigiert, die Sie damals in einem Interview als «Jahrhundertchance für Zürich» bezeichneten. Ist es typisch für diese Stadt, dass man diese Chance nicht genutzt und die Tonhalle Maag aufgegeben hat?
Ich glaube nicht. Es ist doch überall eine komplizierte Geschichte mit den Sälen, schauen Sie sich die Situation in München an: Da wird es wahrscheinlich nie eine vernünftige Lösung geben. Aber es ist schon sehr schade, dass die Tonhalle Maag nicht mehr existiert. Die Akustik war gut, ich mochte den industriellen Charme der Halle und des Quartiers – und die Anbindung an den öffentlichen Verkehr war perfekt.
Wenn Sie jetzt jeweils nach Zürich kommen: Was tun Sie als Erstes?
Oft gehe ich ins Kunsthaus, dort gibt es immer interessante Ausstellungen. Und ganz bestimmt esse ich bei jedem Besuch einmal in der Kronenhalle: Das ist für mich das gute alte Zürich.
Da sind Sie wieder ganz in der Nähe der Oper. Aber dirigiert haben Sie dort nie mehr.
Nein. Das Orchester hat zwar immer wieder nach mir gefragt, aber es sollte nicht mehr dazu kommen. Ich war da ja schon in einer fortgeschrittenen Phase meiner Karriere, ich war in Cleveland, habe regelmässig die Wiener Philharmoniker dirigiert: Da wählt man aus, wenn ein Angebot nicht sonderlich attraktiv ist.
Nun bringen Sie Opern in die Tonhalle: Eine Suite aus Strauss’ «Rosenkavalier» – dem nicht nur Ihre erste, sondern 2008 auch Ihre letzte Aufführung am Opernhaus galt – und Ausschnitte aus «The Exterminating Angel» von Thomas Adès.
Die normale «Rosenkavalier»-Suite von Artur Rodziński habe ich ja nie angerührt. Der Schluss überzeugt mich nicht, und es fehlt so viel schöne Musik! Deshalb habe ich meine eigene Suite zusammengestellt, dreiteilig, mit den Highlights aus jedem Akt. Ich habe sie schon verschiedentlich dirigiert und sie funktioniert wunderbar. Dazu wurde ich gebeten, etwas von Adès zu machen, der die Saison als Creative Chair begleitet. Ich habe in Cleveland viel von ihm aufgeführt, auch diese Suite aus seiner Oper «The Exterminating Angel». Ich kenne ihn gut, und ich mag seine Musik. Deshalb habe ich gesagt: Sehr gerne!
Wenn Sie an Ihre Schweizer Erfahrungen von Mitte der 1980er-Jahre bis heute denken – was hat sich verändert?
Ich sehe überall in den europäischen Orchestern eine ähnliche Entwicklung: Die jungen Musikerinnen und Musiker haben technisch einen wahnsinnig hohen Standard, aber musikalisch sieht es zum Teil anders aus. Die Tradition bröselt gerade ein bisschen in unserem gesamten Betrieb. Das Musikantische geht verloren, und man vergisst, dass dieses Höher-Schneller-Lauter nicht immer die Lösung ist. Das war übrigens genau meine Herausforderung, als ich das Cleveland Orchestra übernommen habe: Als ich dort anfing, haben sie gespielt wie eine perfekt geölte Maschine. Doch die atmende Phrasierung, das Ein- und Ausschwingen einer Linie – das war ihnen vollkommen fremd. Es hat Jahre gedauert, bis gewisse Dinge selbstverständlich wurden.
Ist Ihre eigene Haltung als Dirigent denn dieselbe geblieben? In Ihrer Winterthurer Zeit haben Sie das Musizieren in einem Interview mit Licht verglichen, das durch eine Scheibe fällt: «Das Licht ist die Musik, ich bin die Scheibe. Damit die Musik so klar wie möglich bleibt, muss ich mich so weit als möglich wegstellen.»
Da kommt mir der bereits erwähnte Wolfgang Schneiderhan in den Sinn: Er war ja Konzertmeister bei den Wiener Philharmonikern, und ein Dirigent hat ihn einmal gefragt, wie er denn seine Beethoven-Sinfonie gefunden habe. Da hat Schneiderhan geantwortet: «Ach, ich wusste ja gar nicht, dass Sie auch eine geschrieben haben …» Der Begriff Interpret sagt für mich eigentlich alles: Wir sind Zwischenträger. Wenn man einem Stück das aufdrückt, was man gerade empfindet, hat man seine Aufgabe verfehlt.
Sie würden Ihre damalige Aussage also auch heute noch unterschreiben?
Ja. Gerade in einer Zeit, in der wir vom Hedonismus in den Narzissmus weitergerutscht sind, kann ich mit egozentrischen «Interpretationen» – in Anführungszeichen! – wirklich nichts anfangen.